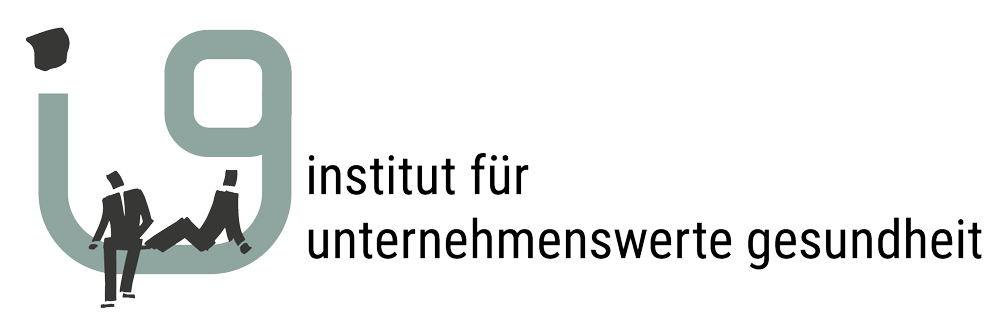Mit der Hilfe der Methode Aktives Zuhören lassen sich Konflikte besser klären. Die Methode entwickelte der amerikanische Psychologe Carl R. Rogers.
Hirsche kämpfen im September/ Oktober, Menschen das ganze Jahr. Anlässe für Konflikte sind bei beiden Spezies ganz ähnlich. Wie beim Rotwild geht es auch bei uns Menschen oft um die Position als Platzhirsch, um Macht, Dominanz, darum, gehört zu werden oder eigene Meinungen durchzusetzen.
„Wie können wir nur ein Miteinander im Team, in der Partnerschaft, in der Familie oder im Verein hinkriegen, ohne in Konflikte zu geraten?“ ist eine häufig gestellte Frage an uns. „Hoffentlich gar nicht“ lautet unsere Antwort. Erstens hätten wir als Mediatorinnen dann nichts mehr zu tun … . Zweitens – und diesmal voller Ernsthaftigkeit – sind Konflikte unerlässlich um Beziehungen zu stärken und zu vertiefen.
Eine Methode, die einen konstruktiven Konfliktlösungsweg unterstützt, ist das Aktive Zuhören von Carl R. Rogers. Der amerikanische Psychologe entwickelte diesen Kommunikationsansatz in den 1950er-Jahren. Verständnis, Vertrauen und gegenseitiger Respekt sind die zentralen Elemente, um Spannungen abzubauen. Diese Methode zielt darauf ab, sich in die Gesprächspartnerin einzufühlen, mitzudenken und dem Gespräch aufmerksam und interessiert zu folgen.
Was ist Aktives Zuhören?
Aktives Zuhören ist mehr als nur das stille Verfolgen eines Gesprächs. Vielmehr lasse ich mich, als Empfänger, mit ganzer Aufmerksamkeit auf die andere Person ein und signalisiere: “Ich nehme dich ernst. Ich will wirklich verstehen, was du meinst und fühlst.”
Carl Rogers beschreibt aktives Zuhören in vier Schritten:
- Wahrnehmen
Der Empfänger hört das Gesagte und nimmt Mimik und Gestik des Senders auf. - Zuordnen/ Interpretieren
Der Sender deutet das Gehörte. Er ordnet und interpretiert dies auf Grundlage seiner Erfahrungen. - Beurteilung
Der Sender beurteilt das Gehörte auf Grund seiner Erfahrungen und Glaubenssätze. - Reaktion/ Antwort
Der Sender reagiert auf das Gehörte, ob verbal oder nonverbal. Er kann auch Fragen stellen, um weitere Informationen zu erhalten.
Rogers ging es dabei neben der verbalen Interaktion auch darum, die nonverbalen Signale aufzunehmen und entsprechend der Wahrnehmung zu reagieren. Ziel ist es, dass sich der Andere verstanden fühlt. Dabei können unterschiedliche Methoden hilfreich sein.
Beim Paraphrasieren, zum Beispiel, gebe ich die Aussage des Gegenübers in eigenen Worten wieder. Dies hat zur Folge, dass jede Seite genau hinhören muss und mögliche Missverständnisse zeitnah ausgeräumt werden können. („Du meinst also, dass …?“).
Beim Verbalisieren von Gefühlen, spreche ich die vermuteten Emotionen des Sprechenden an („Es klingt, als seist du enttäuscht …“).
Dazu gehört eine offene Körperhaltung und Blickkontakt, um Interesse und Präsenz zu signalisieren. Auch vertiefende oder klärende Rückfragen helfen besser zu verstehen. Und vor allem hilft, mein Gegenüber aussprechen zu lassen und das Gesagte nicht zu bewerten. Dabei gilt der Grundsatz, dass Gefühle nicht „verhandelbar“ sind.
Was kann mit Aktivem Zuhören erreicht werden?
- Deeskalation durch Empathie
Wer sich gehört und verstanden fühlt, ist eher bereit, die eigene Sichtweise zu relativieren und auf die andere Seite zuzugehen. Aktives Zuhören reduziert emotionale Spannung und schafft eine Atmosphäre, in der Lösungen möglich werden. - Vermeidung von Missverständnissen
Häufig beruhen Konflikte auf Fehlinterpretationen. Durch aktives Nachfragen und Spiegeln wird sichergestellt, dass Botschaften so ankommen, wie sie gemeint sind. - Förderung gegenseitigen Respekts
Auch wenn man nicht einverstanden ist, zeigt man durch aktives Zuhören Respekt für die Perspektive des anderen. Das stärkt die Beziehung und erhöht die Bereitschaft zur Kooperation. - Raum für Bedürfnisse schaffen
Konflikte basieren oft auf unausgesprochenen Bedürfnissen. Aktives Zuhören hilft, diese Bedürfnisse herauszuarbeiten, ohne sie gleich zu bewerten oder abzulehnen.
Hier ein Beispiel aus der Praxis:
Zwei Kolleg*innen – Frau Meyer und Herr Schmitt – arbeiten im selben Projektteam. Es gab Missverständnisse über Verantwortlichkeiten, was zu Spannungen führte. Herr Schmitt fühlt sich übergangen und macht seinem Ärger Luft.
Herr Schmitt:
„Ganz ehrlich, ich bin sauer. Du hast letzte Woche Entscheidungen getroffen, die wir eigentlich im Team besprechen wollten. Ich stand komplett außen vor – das ist nicht das erste Mal, und es fühlt sich an, als ob meine Meinung keine Rolle spielt.“
Aktives Zuhören durch Frau Berger (als direkt Beteiligte):
„Okay, ich merke, das hat dich wirklich geärgert. Du fühlst dich ausgeschlossen, weil ich die Entscheidung ohne dich getroffen habe – und das ist für dich nicht nur eine Sachfrage, sondern auch ein Punkt von Wertschätzung und Zusammenarbeit. Stimmt das so?“
(Paraphrasieren + emotionale Spiegelung)
(Herr Schmitt nickt, etwas ruhiger)
„Es war nicht meine Absicht, dich außen vor zu lassen – aber ich kann gut verstehen, dass das für dich so rüberkam. Ich will, dass du weißt: Deine Meinung ist mir wichtig. Wollen wir schauen, wie wir solche Entscheidungen künftig transparenter abstimmen?“ (Validierung + Klärungsangebot + Lösungsvorschlag)
Aktives Zuhören wirkt nicht immer sofort – und es erfordert Übung, Geduld und innere Bereitschaft. Die Methode funktioniert nur dann, wenn der Zuhörer ehrlich interessiert ist und sich bemüht, sein eigenes Urteil zeitweise auszusetzen. In Situationen mit extrem hoher emotionaler Ladung oder bei stark verhärteten Fronten kann auch externe Hilfe (z. B. durch Mediation) nötig sein.
Reflexionsfragen für Aktives Zuhören im Alltag:
- Körpersprache
Bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ganz bei der Person? Habe ich eine offene, zugewandte Haltung? Unterbreche ich nicht und lasse Pausen zu? - Inhaltliches Verstehen (Paraphrasieren)
Habe ich in eigenen Worten zusammengefasst, was gesagt wurde? Habe ich nachgefragt, ob ich richtig verstanden habe? - Emotionale Spiegelung
Spreche ich auch Gefühle an („Das klingt für mich frustrierend / verunsichernd“)? Vermeide ich es, Gefühle zu interpretieren oder kleinzureden? - Validierung & Würdigung
Habe ich deutlich gemacht, dass die Sichtweise nachvollziehbar oder legitim ist – auch wenn sie subjektiv ist? - Weiterführende Fragen
Habe ich offene, klärende oder lösungsorientierte Fragen gestellt („Was würde Ihnen helfen, damit umzugehen?“)? - Meta-Kommunikation
Frage ich gelegentlich: „Ist das gerade hilfreich für Sie?“ / „Sollen wir dabei bleiben oder weitergehen?
Zurück zu den Hirschen: all das wäre sicherlich auf dem Brunftplatz des Rotwilds zu viel verlangt. Aber vielleicht wollen wir es gemeinsam versuchen. Ankündigen möchten wir unseren eintätigen Ehrenamtskurs mit dem Thema „Konfliktmanagement und Konfliktmoderation“ am Samstag, 25. Oktober 2025 von 09:30 – 16:30 Uhr. Der Tag findet in unseren Räumen in Marktoberdorf statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Marktoberdorf.